BBU-Wasserrundbrief Nr. 1196, 30. August 2022
Sechs Jahre „Bundes-Spurenstoffdialog“
– was hat er gebracht?
|
| |
Die Debatte über Mikroverunreinigungen in der aquatischen Umwelt und im Trinkwasser ist erstmals journalistenöffentlich am 22.03.22 auf einer Bilanzveranstaltung des Bundesumweltministeriums geführt worden. Dazu fand sich bereits eine Kommentierung im RUNDBR. 1190/S. 2-3.
Hier folgt exklusiv für die LeserInnen des BBU-WASSER-RUNDBRIEFS ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung, auf der die beteiligten Akteure am „Spurenstoffdialog“ ihr Fazit vorgetragen hatten. Für das BMU war schon seit längerem absehbar, dass – insbesondere wegen europarechtlicher Restriktionen (freier Warenverkehr in der EU) – allein mit dem Ordnungsrecht die Mikroschadstoffe in der aquatischen Umwelt nicht aus der Welt zu schaffen sind. Anders die Sicht von Pharmakritikern: Das BMU habe vor der Macht der Pharmabranche gekuscht und die notwendige Regulierung durch eine unverbindliche Gesprächsrunde ersetzt. Wie dem auch sei. In einem aufwendigen Stakeholderprozess wurde mit allen interessierten Lobbygruppen versucht, nach „freiwilligen“ Lösungsansätzen zu suchen. In den ersten vier Jahren wurde in zahlreichen Plenar- und Arbeitsgruppen-Sitzungen eine Einigung über die grundsätzliche Herangehensweise an die Spurenstoffthematik vereinbart. Basierend auf diesen Vereinbarungen starteten dann vor zwei Jahren drei „Runde Tische“, in denen die maßgeblichen Stakeholder (Interessenvertreter) konkrete Lösungen für die jodierten Röntgenkontrastmittel (RKM), den Volatarenwirkstoff Diclofenac und das Antikorrosionsschutzmittel Benzotriazol (BTA) vereinbaren sollten.
|
Spurenstoffminderung: BMU „für höhere Schlagzahl“
|
| |
In ihrem Eingangsreferat zur digital geführten Spurenstoffbilanzveranstaltung am 22. März 2022 versuchte sich die parlamentarische Staatssekretärin im BMU, Bettina Hoffmann (Grüne), an einer Abwägung zwischen „Freiwilligkeit“ und Ordnungsrecht.
Zunächst lobte sie aber „den bemerkenswerten Erfolg des Spurenstoffdialogs“. Bei der Arbeit der „Runden Tische“ h hätte es sich um einen „lösungsorientierten Ansatz“ gehandelt, „der bei einer Fortsetzung sicher weitergehende Ergebnisse erzielen wird“. Gleichwohl hätte sie sich „aber konkretere Vereinbarungen gewünscht“, so die Mahnung der Staatssekretärin. Künftig sei eine „höhere Schlagzahl erforderlich. Wir werden uns im BMU mit Verve dafür einsetzen“, versprach die grüne Umweltpolitikerin – und kündigte an: „Sicher wird es an der einen oder anderen Stelle ein Anwendungsverbot geben müssen.“ Notwendig seien zur Immissionsbegrenzung in den Gewässern mehr Umweltqualitätsnormen für weitere Mikroschadstoffe. Ferner stellte Bettina Hoffmann in Aussicht, dass das beim Dessauer Umweltbundesamt neu eingerichtete Spurenstoffzentrum „als zentrale Anlaufstelle für Chemikalien in Gewässern personell gestärkt werden“ solle. Zu den Aufgaben des Spurenstoffzentrums würden u.a. die Detektion der Eintragsquellen und die Quantifizierung der unterschiedlichen Eintragswege gehören.
Zur Arbeit der drei „Runden Tische“ vertrat Hoffmann den Standpunkt, dass sie sich auch „mehr als nur drei Stoffe gewünscht“ hätte. Denn die Zeit dränge, um zu tatsächlichen Verbesserungen zu kommen.
|
BMU:
Kosten für Spurenstoffeliminierung gerechter umlegen!
|
| |
Hoffmann erwähnte auch den „Orientierungsrahmen“ für den Bau von „vierten Reinigungsstufen“ zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen in den kommunalen Kläranlagen. Der in den ersten vier Jahren des Spurenstoffdialogs erarbeitete Orientierungsrahmen sei der Leitfaden, an dem man sich bei der Auswahl der in Frage kommenden Kläranlagen orientieren könne. Der „Orientierungsrahmen“, dem bislang nur ein Empfehlungscharakter zukomme, müsse „jetzt aber auch umgesetzt werden“.
An den Kosten für Bau und Betrieb der „Vierten Stufen“ müssten sich die Hersteller und Inverkehrbringer von Mikroschadstoffen beteiligen: „Die Kosten müssen gerecht auf mehrere Schultern verteilt werden – und dürfen nicht nur auf die GebührenzahlerInnen abgewälzt werden“ mahnte Hoffmann. Deshalb werde das BMU auf EU-Ebene für eine „erweiterte Herstellerverantwortung“ eintreten. Mit der „erweiterten Herstellerverantwortung“ (s. RUNDBR. 1150/3-4) sollen auch die Hersteller und Inverkehrbringer von Mikroschadstoffen in die finanzielle Pflicht genommen werden, wenn es gilt, die Schäden zu minimieren - beispielsweise durch eine weitergehende Abwasserreinigung. Dazu müsse aber „eine rechtlich sichere Lösung gefunden werden“. Die Parlamentarische Staatssekretärin kündigte an, dass zur „erweiterten Herstellerverantwortung“ die EU-Kommission plane, im Sommer 2022 geeignete Vorschläge zu unterbreiten.
|
Bewertung des Spurenstoffdialogs
durch ein breites Meinungsspektrum
|
| |
In einer sich anschließenden – ebenfalls digital geführten – Diskussionsrunde bewerteten folgende Stakeholder aus ihrer jeweiligen Verbandssicht die Arbeit des Spurenstoffdialogs und der drei „Runden Tische“:
-
Prof. Norbert Jardin vom Ruhrverband als Vertreter der Wasserwirtschaft
-
Tim Bagner vom Deutschen Städtetag in der Perspektive der Kommunen
-
Michael Denk, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im hessischen Umweltministerium, der auch für die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Stellung bezog.
-
Dr. Thomas Kullick vom Verband der Chemischen Industrie (VCI), der zudem die Interessen der Pharmabranche wahrnahm.
-
Paul Kröfges vom BUND für die Umweltverbände
|
Chemieverband erwartet
weiteren Reglementierungsdruck
|
| |
In seiner Bilanz kam Dr. Kullick vom VCI zum Ergebnis, dass sich die Arbeit in den drei „Runden Tischen“ gelohnt habe. In einer Zukunftsperspektive sei damit zu rechnen, „dass wir EU-rechtlich über neue ‚prioritär gefährliche Stoffe‘ sprechen werden“. Aber nicht nur aus der EU-Kommission werde weitergehender Druck zur Reglementierung der Spurenstoffe kommen. Auch die kommunale Wasserwirtschaft und die Umweltverbände würden wohl weiterhin „Dampf unter dem Kessel machen“, so die Erwartungshaltung des VCI-Vertreters.
|
BUND: „Schwafelrunden“ befürchtet
|
| |
In seiner Bilanz kam Dr. Kullick vom VCI zum Ergebnis, dass sich die Arbeit in den drei „Runden Tischen“ gelohnt habe. In einer Zukunftsperspektive sei damit zu rechnen, „dass wir EU-rechtlich über neue ‚prioritär gefährliche Stoffe‘ sprechen werden“. Aber nicht nur aus der EU-Kommission werde weitergehender Druck zur Reglementierung der Spurenstoffe kommen. Auch die kommunale Wasserwirtschaft und die Umweltverbände würden wohl weiterhin „Dampf unter dem Kessel machen“, so die Erwartungshaltung des VCI-Vertreters.
|
Kommunale Kläranlagenbetreiber
skeptisch gegenüber der „4. Stufe“
|
| |
Genau eine gegenteilige Meinung vertrat Prof. Dr. Jardin vom Ruhrverband. Er verwahrte sich gegen eine flächendeckende Einführung der „Vierten Reinigungsstufe“. Er sei froh, dass es gelungen sei, „den Angriff auf die Größenklasse III abzuwehren“. Gemeint war damit, dass für ihn als Vertreter der kommunalen Kläranlagenbetreiber ein Bau von „Vierten Reinigungsstufen“ bei den mittelgroßen Kläranlagen nicht in Frage gekommen sei.
Das bezeichnete wiederum Dr. Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt als Popanz. Weder das Umweltbundesamt noch andere ernst zu nehmende Beteiligte am Spurenstoffdialog hätten den flächendeckenden Bau von „Vierten Reinigungsstufen“ verlangt.
Der Ruhrverbands-Chef ließ sich durch den Einspruch von Rechenberg aber nicht beirren. Jardin nahm für die kommunalen Kläranlagenbetreiber in Anspruch, dass sie im Spurenstoffdialog “den differenzierten Blick durchgesetzt“ hätten: „Weg allein und ausschließlich von der Aufrüstung der kommunalen Kläranlagen. Das Thema ist viel breiter.“ Wegen der zunehmenden Niedrigwasserproblematik seien Maßnahmen zur Reduzierung der Mikroschadstoffe noch vordringlicher – bevorzugt durch das Abfangen der Problemstoffe schon in der Anwendung. So könnten beispielsweise in Mülheim a.d.R. die Röntgenkontrastmittel durch eine separate Abtrennung mit Urinauffangbeuteln und Urinseparationstoiletten „rechnerisch um 40 Prozent reduziert werden“. Er fasse den Spurenstoffdialog „als ersten Schritt in die richtige Richtung auf“.
|
Spurenstoffminderung:
Erfolgskontrolle soll in der Ruhr stattfinden
|
| |
Norbert Jardin betonte, dass die „erweiterte Herstellerverantwortung“ und die Finanzierung des Kläranlagenausbaus für die kommunale Wasserwirtschaft an erster Stelle stehen würden. Zudem sei es wichtig, dass Finanzmittel nicht nur für die „Vierte Reinigungsstufe“ sondern „auch für das Stopfen der Quellen“ bereitgestellt werden müssten. Wenn zudem Informationskampagnen nicht greifen würden, müssten stringentere Mittel zur Anwendung gebracht werden. Ferner müsse „das absolut notwendige Monitoring“ gewährleistet werden. Prof. Jardin bot die Ruhr für eine Erfolgskontrolle an, da die Ruhr schon jetzt wie kaum ein anderer Fluss einem Monitoring unterzogen werde.
|
„Der Erfolg muss in den Gewässern nachweisbar sein!“
|
| |
Michael Denk, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im Hessischen Umweltministerium, bewertete als Vertreter der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) den Spurenstoffdialog und die Arbeit der drei „Runden Tische“ „im großen und ganzen als Erfolg“. „Aber am Ende des Tages muss der Erfolg in den Gewässern messbar sein!“
Lt. Michael Denk würden die Länder große Erwartungen in das neue Spurenstoffzentrum setzen. Das Spurenstoffzentrum müsse dabei behilflich sein, die kosteneffizientesten Maßnahmen zur Reduktion der Mikroschadstoffe herauszufinden. Dazu müsse das BMU die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen für das Spurenstoffzentrum bereit stellen.
Denk erläuterte ferner, dass der separat geführte Spurenstoffdialog im Südhessischen Ried „ein großes Interesse der Kommunen am Bau von Vierten Reinigungsstufen zu Tage gebracht hätte“. Die interessierten Kommunen wollten sich als „Modellkommunen“ präsentieren. Die „Modellkommunen“ könnten als gutes Beispiel für noch zögerliche Kommunen fungieren. Im Hinblick auf den Bau und Betrieb von „Vierten Reinigungsstufen“ sei aber aus der Sicht der Länder die Klärung der Finanzierungsfrage prioritär – „sonst treten wir weiterhin auf der Stelle“. Wie seine Vorredner betonte auch Denk, dass ein gutes Monitoring wichtig sei, um den Erfolg der angestrebten Reduktionsmaßnahmen messen zu können.
|
Städtetag: „Kennzeichnungspflicht
auf der Medikamentenschachtel!“
|
| |
Tim Bagner vom Deutschen Städtetag stufte den Spurenstoffdialog „schon deshalb als gut ein, weil man in den Kontakt mit InteressenvertreterInnen gekommen ist, mit denen man es bis dato nicht zu tun hatte“. So hätten Städtetag und Landwirtschaft bis jetzt nicht so viel miteinander zu tun gehabt.
Die für ihn noch offenen Fragen seien die vakante Finanzierung der „Vierten Reinigungsstufen“ und die rechtliche Verankerung der „erweiterten Herstellerverantwortung“. Die von Hoffmann in Aussicht gestellte Implementierung der „erweiterten Herstellerverantwortung“ in der anstehenden Neufassung der alten EG-Kommunalabwasserrichtlinie werde nach seiner Einschätzung viel zu lange dauern. Deshalb müsse man nach Ansicht des Städtetages „schon mal im deutschen Recht schauen, was man erreichen könne“. Für ihn liege eine Analogie zum Abfallrecht auf dem Tisch: Denn ähnlich wie bei den Entsorgungshinweisen im Abfallsektor brauche es „ganz konkrete Hinweise auf den Medikamentenschachteln“. Wie schon zuvor Prof. Jardin vom Ruhrverband sprach sich auch Banger für eine Kennzeichnungsverpflichtung für die richtige Entsorgung von Altmedikamenten aus: Reste von Medikamenten dürften nicht länger auf Grund fehlender Kennzeichnung über die Kloschüssel entsorgt werden.
|
Ist Voltaren ein „Life-Style-Medikament“?
|
| |
In seinem Vortrag über die Ergebnisse des „Runden Tisches“ zu Diclofenac war Herrn Dr. Jörg Wagner vom BMU die Unvorsichtigkeit unterlaufen, Voltaren als „Livestyle-Medikament“ einzustufen. Das rief dann sofort im Chat zur Veranstaltung die Vertreter der Pharmabranche auf den Plan:
„Diclofenac ist KEIN Lifestyle-Produkt, es ist ein zugelassenes und sehr wirksames Arzneimittel!“
Ein anderer Teilnehmer der Bilanzveranstaltung widersprach:
„Es wird aber wie ein Lifestyle- Produkt beworben....“
Philip Heldt, der Umweltexperte der nordrhein-westfälischen Verbraucherschutzzentrale, setzte nach:
„Und es wird massenhaft als Lifestyle-Produkt genutzt!“
Dr. Thomas Kullick vom Chemieverband sah das anders:
„Lifestyle ist für mich, wenn ich mich durch ein Produkt positiv darstellen kann, eine ‚Salbe‘ taugt da wenig bzw. ist eher ‚unsexy‘!“
Hintergrund des Schlagabtausches war die bisherige Machart der TV-Werbung für Voltaren. Der „Runde Tisch Diclofenac“ hat aber selbst nach dem Urteil von Paul Kröfges vom BUND – einem maßgeblichen Akteur beim „Runden Tisch“ - dazu geführt, dass die Werbung für Voltaren modifiziert worden sei: Voltaren werde „nicht mehr als Allheilmittel für alle Altersbeschwerden“ präsentiert, so auch der Eindruck von Dr. Wagner vom BMU. Wagner hatte zuvor ausgeführt, dass viele ältere Leute
„ein Mehr an Lebensqualität durch Diclofenac“ empfinden würden. Für eine Reduktion der Voltaren-Verwendung müsse „eine festsitzende Erwartungshaltung geändert werden. Das geht nicht durch einen Schnips des Gesetzgebers. Das braucht eine längere gesellschaftliche Debatte. Das sind Prozesse, die sich über Jahre hinziehen, weil Voltaren als Lifestyle-Medikament angesehen wird.“
|
„Herstellerverantwortung ist,
wenn wir die Werkskläranlagen optimieren“
|
| |
Dass sich die Hersteller und Inverkehrbringer von Chemikalien, die letztlich als Mikroschadstoffe in der aquatischen Umwelt enden, an den Bau- und Betriebskosten von „Vierten Reinigungsstufen“ auf kommunalen Kläranlagen beteiligen sollen, war bei den betreffenden Branchen auf wenig Begeisterung gestoßen. Man habe bereits beträchtliche Mittel aufgewandt, um “Vierte Reinigungsstufen“ in den produzierenden Betrieben zu finanzieren. So argumentierte beispielsweise ein Mitarbeiter des Darmstädter Chemieunternehmens Merck KGaA:
„Für unsere Abwasserbehandlungsanlagen übernehmen wir die Herstellerverantwortung und gehen dabei über den derzeitigen Stand der Technik hinaus.“
Es seien darüber hinaus „viele weitere Beispiele von leistungsstarken Kläranlagen sowie Vorbehandlungsanlagen in der Chemischen Industrie“ zu finden. Soll heißen: Ein finanzielles Engagement bei Bau und Betrieb von „Vierten Reinigungsstufen“ auch auf kommunalen Kläranlagen erübrige sich somit nach Auffassung der Chemie- und Pharmabranche. Zur Erinnerung: BMU-Staatsekretärin Bettina Hoffmann hatte eingangs der Tagung dafür plädiert, die Industrie an den Kosten zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen auf kommunalen Kläranlagen zu beteiligen. Man darf deshalb gespannt sein, wie die Bundesregierung dieses Ansinnen der Staatssekretärin gegen den Widerstand der Industrie durchsetzen wird.
|
Voltaren:
Führt „Wischen statt Waschen“ zum Erfolg?
|
| |
Dr. Jörg Wagner, bisher im BMU als Unterabteilungsleiter Wasserwirtschaft für den Spurenstoffdialog zuständig, hatte auf der Bilanzveranstaltung die Ergebnisse des „Runden Tisches Diclofenac“ vorgetragen. Wagner war zugleich der Moderator des „Runden Tisches“ zu diesem Schmerz- und Rheumamittel.
Nach langwierigen und manchmal auf der Kippe stehenden Diskussionen habe man sich in zahlreichen Plenar- und Arbeitsgruppensitzungen vornehmlich darauf einigen können, den PatientInnen den Ratschlag „Wischen statt Waschen“ mit auf den Weg zu geben. Das bedeutet: Nach dem Auftrag der diclofenac-haltigen Salben solle man zuerst die Hände an einem Stück Papier (beispielsweise von einer Küchenpapierrolle) abwischen. Das diclofenac-belastete Papier solle anschließend in der Totalmülltonne entsorgt werden. Erst nach dem Wischen sollten dann die weitgehend diclofenac-freien Hände abgewaschen werden.
Auf der Tagung wurden zweifelnde Fragen laut, ob man mit dem Ratschlag „Wischen statt Waschen“ tatsächlich zu einer signifikanten Entlastung des Abwasserpfades mit Diclofenac beitragen könne – zumal Diclofenac auch in Form von Tabletten eingenommen werde. So erkundigte sich beispielsweise von Frau Dr. Ursula Maier, Fachfrau für Mikroschadstoffe im Stuttgarter Umweltministerium, woher man überhaupt wisse, „dass der Haupteintrag über die Verwendung von Salben - und nicht über die Einnahme als Tabletten - erfolgt?“
In der Beantwortung der Frage wurde u.a. auf Untersuchungen von HamburgWasser in dem ökologisch inspirierten Neubaustadtviertel „Jensfelder Aue“ verwiesen. In dem Neubaustadtteil werden Schwarzwasser aus den Toiletten und Grauwasser aus den sonstigen Haushaltsbereichen getrennt gesammelt. fortgeleitet und dann verwertet bzw. gereinigt. Dabei habe sich gezeigt, dass 90 Prozent des Diclofenacs im Grauwasser, das vom Duschen und Waschen herrührt, gefunden worden waren. Der geringe Tablettenanteil sei darauf zurückzuführen, dass Diclofenac nach oraler Aufnahme zum Großteil in pharmakologisch inaktive Metabolite umgesetzt und nur ein kleiner Teil als unverändertes Diclofenac ausgeschieden wird.
Die skeptischen Stimmen zum Erfolg von „Wischen statt Waschen“ wollten allerdings nicht verstummen. Zum einen würden sich höchstwahrscheinlich nicht alle VoltarenawenderInnen an diese Vermeidungsmethode halten. Zum anderen würde der größte Teil von Votaren und verwandten Produkten nach der Applikation auf schmerzenden Gelenken und anderen Körperteilen beim Duschen oder beim Waschen von diclofenac-belasteten Kleidungsstücken in den Abwasserpfad gelangen. Insofern werde der „Runde Tisch Diclofenac“ mit seiner Empfehlung „Wischen statt Waschen“ allenfalls einen Minderungserfolg von zehn bis zwanzig Prozent erreichen. Das sei aber viel zu wenig, um zu einer tatsächlichen Entlastung der diclofenac-sensiblen Fließgewässerorganismen beizutragen, argumentierte beispielsweise die Spurenstoffexpertin Prof. Dr. Rita Triebskorn von der Universität Tübingen.
Den Skeptikern wurde entgegnet, dass man sich beim „Runden Tisch“ nicht mit der Empfehlung „Wischen statt Waschen“ begnügt habe. So sei man dabei, die Ärzte und Apotheker sowie die Mitglieder von Sportvereinen für das Thema zu sensibilisieren. U.a. sei bereits ein entsprechender Aufsatz im Deutschen Ärzteblatt erschienen, weitere Aufsätze in Apothekerzeitschrif-ten und Sportverbandsmagazinen seien in Vorbereitung. Insofern könne man annehmen, dass es im Verlauf der Zeit zu einer weiteren Entlastung der aquatischen Umwelt und der Rohwasserressourcen von Diclofenac kommen werde.
Mehr zum „Spurenstoffdialog“ in den WASSER-RUNDBR. 1190/2-4, 1188/1, 1167/2 und 1147/1-4.
|
Der BBU-WASSER-RUNDBRIEF berichtet
regelmäßig über die Angriffe auf die kommunale Daseinsvorsorge.
Interessierte können kostenlose Ansichtsexemplare anfordern.
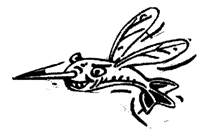
|